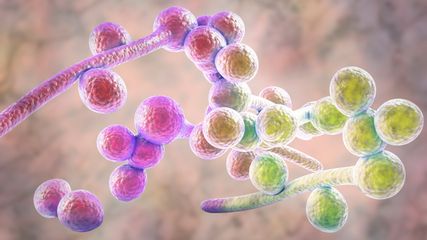Antimykotika-resistente Pilze sind in Österreich (noch) ein seltenes Problem
Bericht:
Reno Barth
Vielen Dank für Ihr Interesse!
Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.
Sie sind bereits registriert?
Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:
Sie sind noch nicht registriert?
Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich
zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)
Ebenso wie Antibiotikaresistenzen werden auch Resistenzen von Pilzen gegen Antimykotika weltweit zum Problem – von dem Österreich glücklicherweise bislang kaum betroffen ist. Schwierigkeiten bei der Testung und der Interpretation der Resultate sowie die inhärent schlechte Behandelbarkeit mancher Pilzerkrankungen komplizieren die Situation.
Die Resistenz eines Pilzes gegen ein Antimykotikum entsteht durch ein komplexes Zusammenspiel von genetischer Adaption, Medikamentenspiegel und Lokalisation der Infektion. Abdomen und Mundhöhle stellen das Reservoir für die Resistenzbildung dar. Fallen die Medikamentenspiegel aufgrund schlechter Penetration an diesen Lokalisationen auf subtherapeutisches Niveau, so fördert dies auch im Falle von Pilzen die Resistenzentwicklung.
Unterschiedliche Resistenzen
In der Bewertung von mikrobiologischen Resistenzen ist immer zwischen der Resistenz in vitro und der klinischen Resistenz zu unterscheiden, so Univ.-Prof. Dr. Cornelia Lass-Flörl, Direktorin des Instituts für Hygiene und Medizinische Mikrobiologie der Medizinischen Universität Innsbruck. Die mikrobiologische Resistenz in vitro wird bestimmt durch die minimale Hemmkonzentration (MHK) der infrage stehenden Substanz. Die Interpretation erfolgt anhand etablierter klinischer Breakpoints (CBP). Solche Breakpoints hat man zur Verfügung, wenn die MHK mit gesicherten Outcome-Daten aus Studien korreliert, so Lass-Flörl: „Wenn der Breakpoint überschritten wird, würden wir in der Klinik nicht auf diese Substanz zurückgreifen. Schwierig wird es, wenn wir nur epidemiologische Daten haben, auf die wir unsere Entscheidungen stützen können.“
Klinische Resistenz liegt vor, wenn die Infektion unter Therapie persistiert oder sich verschlechtert – unabhängig von In-vitro-Daten. Lass-Flörl sieht hier die größere Herausforderung – vor allem im hämatoonkologischen Bereich – und verweist auch auf neue Konzepte der Definition von Resistenz, die nicht mehr auf der Resistenztestung in vitro beruhen, sondern auf dem genetischen Profil des Erregers und dem Vorhandensein bekannter Resistenzgene. Beispielsweise ist eine Echinocandin-Resistenz gegen Candida spp. praktisch immer assoziiert mit Aminosäure-Variationen an zwei bekannten Stellen des Genoms. Tritt Resistenz gegen ein Antimykotikum auf, so sind üblicherweise mehrere Vertreter derselben Substanzklasse betroffen. Multiresistenzen sind bei Pilzen derzeit insgesamt noch selten, werden allerdings mit zunehmender Häufigkeit beobachtet.
Herausforderungen im klinischen Alltag
Für den klinischen Alltag stellen sich folgende relevante Fragen, so Lass-Flörl: Wie häufig treten Resistenzen auf? Wie leicht können sie durch Therapie induziert werden? Wie häufig führt Resistenz zu Therapieversagen? Wie kann ich das vermeiden? Da es sich bei Resistenz um ein multifaktorielles Geschehen handelt, lassen sich diese Fragen nicht immer zufriedenstellend beantworten.
Die Probleme beginnen bei der Resistenztestung. Dies liege an den verschiedenen verfügbaren Methoden, mit denen die MHK ermittelt wird, vor allem jedoch an deren Interpretation. Eine wichtige Größe ist der epidemiologische Grenzwert („epidemiological cut-off“; ECOFF), der dann ins Spiel kommt, wenn es zur klinischen Auswirkung einer bestimmten Resistenz keine Daten aus Studien gibt. In diesem Fall wird die Frage gestellt, ob die MHK innerhalb der Normalverteilung der MHK-Werte für diesen Pilz und dieses Antimykotikum liegt. Ist dies der Fall, so spricht man von „wild type“, ist dies nicht der Fall, geht man von einem „non-wild type“ aus. Streng genommen spreche man in solchen Fällen nicht von Resistenzen, so Lass-Flörl.
In der Klinik bleibt die schwierige Entscheidung, wie in solchen Fällen vorzugehen ist. Die Interpretation grenzwertiger Resultate ist dabei besonders schwierig. Das Clinical & Laboratory Standards Institute (CLSI) schlägt für solche Werte den Terminus „intermediate“ vor. Außerdem gibt es die Kategorie „susceptible-dose-dependent“ (SDD), die allerdings nur für Fluconazol gegen Candida verwendet wird.
Im Gegensatz dazu geht EUCAST (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing) von einer „area of technical uncertainty“ (ATU) aus und vermeidet den Begriff „intermediate“. Spricht ein Mikroorganismus auf eine Therapie an, wenn am Ort der Infektion eine höhere Wirkstoffkonzentration erreicht werden kann, so verwendet EUCAST den Terminus „suszeptibel bei erhöhter Exposition“. Fällt die MHK eines Isolats in die ATU, so sollen den Klinikern weitergehende Empfehlungen gegeben werden, wie zum Beispiel „weitere Tests durchführen“. Lass-Flörl: „In der Praxis wird man den Test wiederholen und darüber hinaus nach molekularbiologischen Hinweisen auf Resistenzen suchen. Aber auch da gibt es Unsicherheiten, insbesondere wenn man bei Wiederholung des Tests durch biologische Varianz zu unterschiedlichen Ergebnissen kommt.“ Erschwerend kommt hinzu, dass für einzelne Pilze und Antimykotika seitens der verschiedenen Fachgesellschaften und Zulassungsbehörden unterschiedliche Einschätzungen bestehen.
In-vitro- und In-vivo-Resistenz korrelieren bei manchen Pilzen unzureichend
Die Unterscheidung zwischen primärer und sekundärer Resistenz ist für die Klinik von geringer Bedeutung. Wichtig ist hingegen die Korrelation zwischen Resistenz in vitro und Resistenz in vivo. Diese ist im Falle von Candida sp. gut gesichert. Für die Azole hat die In-vitro-Testung hohen prädiktiven Wert. Bei suszeptiblen Isolaten ist zu 85% auch mit klinischem Erfolg zu rechnen. Bei resistenten Isolaten liegt die Erfolgswahrscheinlichkeit hingegen unter 50%. Auch für die Echinocandine besteht eine sehr starke, für Amphotericin B moderate, aber auch noch eher gute Korrelation. Bei Aspergillus sp. korrelieren In-vitro- und In-vivo-Daten schon schlechter. Azol-suszeptible Infektionen zeigen tendenziell besseres Ansprechen, sehr hohe MHK (≥16mg/l) sprechen für schlechte Wirksamkeit. In manchen Studien ist keine klare Korrelation zwischen MHK und klinischen Outcomes erkennbar. Für die Echinocandine sind keine CBP definiert. Sie sind nicht kurativ für Aspergillose. Bei Amphotericin B besteht eine brauchbare Korrelation von Testergebnissen mit der Klinik, wobei manche Spezies aus der Reihe fallen.
Bei allen anderen Pilzen fehlen die Daten bzw. fehlen die Korrelationen. Viele dieser seltenen Organismen sind generell schwer zu behandeln. So ist Fusarium sp. inhärent resistent gegen Echinocandine, für Azole ist die Korrelation schwach, für Amphotericin B bestenfalls moderat. Lass-Flörl: „Amphotericin B ist eine der wenigen Optionen, aber viele Fusarium-Isolate haben hohe MHK und die klinischen Ergebnisse sind oft dürftig.“
Derzeit beruhigende Resistenz-situation in Österreich
In Österreich ist die Situation derzeit noch weitgehend beruhigend. Für den AURES-Resistenzbericht 2022 wurden 363 verschiedene Hefepilze aus Blutkulturen erfasst.1 Sie zeigen, dass Candida albicans nach wie vor der häufigste Erreger ist, gefolgt von C. glabrata (Nakaseomyces glabratus), C. parapsilosis und C. tropicalis. Die Verteilung der einzelnen Candida-Spezies über den beobachteten Zeitraum ist relativ stabil geblieben. Die meisten Candidämien fanden sich so wie in den Vorjahren auf Intensivstationen und chirurgischen Stationen, gefolgt von internen Abteilungen.
Nach wie vor gilt, dass eine geringe Resistenzrate bei Candida und anderen Hefen, die aus der Blutkultur nachgewiesen wurden, zu beobachten ist. Die höchste Resistenzrate wurde für Fluconazol gefunden, hier sind 4,6% der getesteten Stämme resistent. Die Resistenzraten für die anderen getesteten Azole liegen zwischen 0,0 und 4,1%. Die Resistenzsituation bei Echinocandinen ist zurzeit ebenso wenig besorgniserregend. Zwar lag die Resistenzrate bei Anidulafungin bei 4,5%, wobei C. albicans erstaunlicherweise am stärksten betroffen war. Diese zeigen aber wahrscheinlich nur eine phänotypische und keine klinisch wirksame Resistenz. Generell ist keine Tendenz zu einer stärkeren Resistenzentwicklung zu beobachten. Bei der Beurteilung der MHK-Verteilung der einzelnen Candida-Arten über den gesamten Beobachtungszeitraum zeigen sich keine besonders auffälligen Veränderungen. Lass-Flörl: „Natürlich gibt es Einzelfälle, aber wir können sagen, dass wir in Österreich bei Candida kein Resistenzproblem haben.“
Unter den 263 Schimmelpilzkulturen dominierten Aspergillus-Spezies. Auch in dieser Gruppe von Pilzen sind die Resistenzen gering. Bei den Non-Aspergillus-Isolaten sind hingegen keine klinischen Breakpoints definiert, typischerweise werden hohe MHK benötigt. Lass-Flörl: „Die klassischen Azol-resistenten Spezies haben wir in Österreich nicht gefunden.“ Die Probleme liegen oft im Detail bzw. in Einzelfällen. So wurde in Vorarlberg ein aus Südamerika importierter Fall von Candida auris registriert, der jedoch klinisch gut versorgt werden konnte. Aus Salzburg wurde ein Fall von Pan-Azol-resistentem Fusarium oxysporum berichtet, Oberösterreich vermeldete einen Fall von Pan-Azol-resistentem Fusarium solani. In Tirol kam es zu Fusarium-solanii-Breakthrough-Infektionen unter Olorofim sowie – wie im Burgenland – zum Auftreten von Aspergillus terreus, in der Steiermark trat ein Azol-resistenter Aspergillus fumigatus ebenso auf wie Echinocandin-resistente C. albicans. Aus Wien werden zahlreiche solche Einzelfälle mit zum Teil sehr seltenen Pilzen sowie ein Fall von Fluconazol-resistentem Cryptococcus neoformans berichtet.
Alles in allem könne man in Österreich von einer guten Resistenzlage sprechen, so Lass-Flörl. Die korrekte Speziesbestimmung sei jedoch das A und O im Management. Seltene Pilze bleiben im Einzelfall abzuklären, da Breakpoints für die Wirksamkeit von Antimykotika oft nicht bekannt sind. Auch die Rolle verschiedener neuer Antimykotika könne aktuell noch nicht bewertet werden.
Quelle:
„Resistenzen gegenüber Antimykotika in Österreich“, Vortrag von Univ.-Prof. Dr. Cornelia Lass-Flörl, Innsbruck, am 20. März 2025 im Rahmen des ÖIK in Saalfelden
Literatur:
1 Lass-Flörl C: Resistenbericht Schimmelpilze. In: Resistenzbericht Österreich – AURES 2022
Das könnte Sie auch interessieren:
HIV-Infektion im Alter: Was sind die Herausforderungen?
Dank des medizinischen Fortschritts ist HIV heute eine chronische behandelbare Erkrankung mit nahezu normaler Lebenserwartung. Immer mehr HIV-positive Menschen erreichen ein höheres ...
Die neue Candida-Leitlinie 2025 in der klinischen Praxis
2025 ist das Update der globalen Leitlinie zum Management von Candida-Infektionen erschienen. Die Guideline fasst die aktuelle Evidenz in Form übersichtlicher, praxisnaher Algorithmen ...
Neue Möglichkeiten der Prävention durch Impfung
In den letzten Jahren wurden Impfstoffe gegen mehrere Erkrankungen auf den Markt gebracht, für die es bislang keine Möglichkeit der Impfprophylaxe gab. Das betrifft die Tropenkrankheiten ...