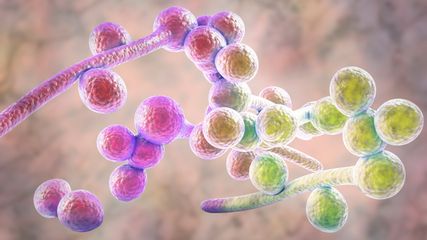Neue Möglichkeiten der Prävention durch Impfung
Bericht:
Reno Barth
Vielen Dank für Ihr Interesse!
Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.
Sie sind bereits registriert?
Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:
Sie sind noch nicht registriert?
Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich
zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)
In den letzten Jahren wurden Impfstoffe gegen mehrere Erkrankungen auf den Markt gebracht, für die es bislang keine Möglichkeit der Impfprophylaxe gab. Das betrifft die Tropenkrankheiten Dengue und Chikungunya, die in Europa als Reiseinfektionen eine gewisse Relevanz haben, aber auch das in Europa verbreitete respiratorische Synzytial-Virus (RSV).
Für eine Reihe von Infektionskrankheiten stehen seit Kurzem erstmals Impfungen zur Verfügung. Dies betrifft mehrere Erkrankungen, die von Arboviren verursacht und durch die Asiatische Tigermücke (Aedes albopictus) sowie die Gelbfiebermücke (Aedes aegypti) übertragen werden – konkret Dengue, Zika und Chikungunya. In großen Teilen der Welt sind zumindest ein oder zwei, in vielen Ländern alle drei ursächlichen Viren beheimatet. Europa ist in geringem Umfang betroffen, mit gelegentlichen Ausbrüchen in Spanien, Italien und Frankreich. Bei der Mehrzahl der in Europa auftretenden Erkrankungen handelt es sich um importierte Fälle, erläuterte Dr. Sabine Koppelstätter von der Innsbrucker Universitätsklinik für Innere Medizin II. Gelegentliche kleine Ausbrüche kommen jedoch vor. In Österreich ist die Tigermücke mittlerweile heimisch, autochthone Übertragungen wären also möglich.
Dengue: Impfung wird nach durchgemachter Infektion empfohlen
Die Hauptausbreitungsgebiete des Dengue-Virus sind Mittel- und Südamerika, sowie Teile Asiens. Weltweit kam es 2024 zu rund 13 Millionen Erkrankungen mit 8500 gemeldeten Todesfällen. Nur rund 25% der Infizierten entwickeln Symptome, in der Regel im Sinne einer grippalen Symptomatik mit Myalgien sowie Exanthem. Es sind vier Serotypen bekannt, eine Infektion hinterlässt lebenslange Immunität gegen den Serotyp sowie für ein bis zwei Jahre Kreuzimmunität für alle Subtypen. Danach werden Zweitinfektionen mit einem anderen Serotyp jedoch problematisch, da sie ein erhöhtes Risiko (2–4%) für einen hämorrhagischen, also schweren Verlauf mit sich bringen.
Aktuell sind zwei Lebendimpfstoffe (Dengvaxia und Qdenga) verfügbar. Als Reiseimpfung wird in Österreich Qdenga empfohlen, die primär als Kinderimpfung in Endemiegebieten und auf der Basis des Dengue-Virus 2 entwickelt wurde. Die Wirkung dürfte jedoch über alle Altersgruppen hinweg gut sein, wobei allerdings für die über 60-Jährigen die Daten fehlen. Ebenso ist über die Wirksamkeit gegen die Serotypen 3 und 4 nichts bekannt, da dies in den Studien nicht untersucht wurde, obwohl Qdenga auch gegen diese beiden Serotypen immunisieren sollte. Es werden zwei Impfdosen im Abstand von drei Monaten empfohlen – ob ein Booster benötigt wird, ist noch unklar. Ebenso gibt es noch keine Daten zu einem möglichen „antibody dependent enhancement“ (ADE). Der Impfschutz (Endpunkt: Hospitalisierungen) wird mit 84,1% angegeben. Dengvaxia wird zur Immunisierung von Kindern in Endemiegebieten verwendet und nicht als Reiseimpfung empfohlen.
Mit PIII-Butantan DV ist möglicherweise bald ein weiterer Lebendimpfstoff verfügbar, der nur einmal verimpft werden muss, um einen Impfschutz über mehrere Jahre zu erzeugen. Auch hier werden hohe Schutzraten gegen die Serotypen 1 und 2 angegeben, während für 3 und 4 die Daten fehlen.
Die Dengue-Impfung wird vor Reisen in Endemiegebiete bei bereits durchgemachter Dengueinfektion empfohlen, bei Langzeitaufenthalt und für Risikopersonen. Sollte es zu einer Dengueinfektion gekommen sein, soll die Impfung frühestens sechs Monate nach der Infektion erfolgen.
Chikungunya: anhaltende Gelenksschmerzen keine Seltenheit
Chikungunya ist in Mittel- und Südamerika endemisch, es kommt allerdings auch immer wieder zu Ausbrüchen in Teilen Afrikas und Asiens mit insgesamt jährlich ca. einer Million Fälle. Es handelt sich um Alphaviren mit nur einem Serotyp und vier Genotypen. Eine Infektion führt zu lebenslanger Immunität. Die Infektionen verlaufenzu 75% symptomatisch mit Fieber, Arthralgien und Exanthem. In 25% treten prolongierte Gelenkschmerzen bzw. Tendosynovitis auf, die bei rund einem Drittel der Betroffenen für mehr als ein Jahr anhalten.
Gegen Chikungunya steht mittlerweile ein Lebendimpfstoff (Ixchiq) zur Verfügung. Er beruht auf einem attenuierten Virus mit einer Deletionsstelle im Genom, die die Vermehrung des Virus verlangsamt, sodass das Immunsystem rechtzeitig mit der Bildung von Antikörpern reagieren kann. Nach der Impfung kommt es für eine Woche zu geringer Virämie, nach 24 Monaten haben 97% der Geimpften schützende Antikörper, was auch für die Altersgruppe ab 65 Jahren gezeigt wurde. Bereits am Tag 14 sind hohe Antikörpertiter nachweisbar. Seit Juni 2024 besteht in der EU die Zulassung ab 18 Jahren. Die Impfung wird einmal verabreicht. Eine Zulassungserweiterung für die Altersgruppe ab 12 Jahren wird in naher Zukunft erwartet, für den Einsatz bei jüngeren Kindern laufen Studien.
Ein Totimpfstoff auf Basis von „virus-like particles“ mit Aluminium als Adjuvans ist in Europa noch nicht zugelassen, dies könnte sich in den kommenden Monaten ändern: Eine FDA-Zulassung liegt bereits vor. Impfempfehlungen für Chikungunya bestehen bei Reisen in Epidemiegebiete, bei einem aktuellen Ausbruch sowie für Laborpersonal.
In Brasilien wird nun versucht, die Mücken gegen Chikungunya zu impfen. Dazu sollen Aedes-Mücken ausgesetzt werden, die mit dem Bakterium Wolbachia infiziert sind, was dazu führt, dass sie das Chikungunya-Virus nicht mehr übertragen können. Nach Schätzungen müssten rund 25% der Aedes-Population Wolbachia in sich tragen, um das Infektionsgeschehen relevant einbremsen zu können.
Malaria: Impfung gegen Plasmodium falciparum wird Realität
Eine der weltweit gefährlichsten Infektionskrankheiten ist die Malaria. Laut Daten des Malaria-Reports der WHO kam es 2024 zu 240 Millionen Infektionen mit 600000 Todesfällen, wovon zu 80% Kinder unter fünf Jahren betroffen waren.
Erfreulicherweise nimmt die Zahl der Malaria-freien Länder beständig zu. So konnten 2023 Ägypten, die Türkei und der Großteil der Arabischen Halbinsel erstmals als Malaria-frei eingestuft werden. Am stärksten betroffen ist nach wie vor Afrika – sowohl im Hinblick auf die Infektionszahlen als auch auf die der Todesfälle. Mehrere Faktoren erschweren die Infektionskontrolle: So kommt es durch den Klimawandel zu Veränderungen von Temperatur und Niederschlagsmengen und damit zu einer geografischen Verschiebung von Endemiegebieten. Weiters wird eine Zunahme an Insektizid- und Parasitenresistenzen beobachtet. Es kommt zur Ausbreitung von „urbanisierten“ Anophelen (A. stephensi), wodurch in den Städten eine Malaria-naive Bevölkerung erstmals mit Malaria konfrontiert wird. Auch verschieben bestimmte Anopheles-Arten ihre tageszeitliche Aktivität in Richtung Morgenstunden und umgehen damit imprägnierte Bettnetze. Dies alles unterstreicht die Bedeutung einer Impfung gegen Malaria, erläuterte Koppelstätter.
Aktuell sind zwei Impfstoffe für Säuglinge und Kleinkinder in endemischen Gebieten zugelassen, nämlich Mosquirix mit einer Schutzrate von 36–56% sowie R21/Matrix-M mit einer Schutzrate von 68–75%. Beide Vakzinen basieren auf dem wichtigsten Sporozoiten-Oberflächenantigen, dem Circumsporozoit-Protein (CSP). Durch die Kombination von Impfung, Barrieremaßnahmen und Mückenschutz kann eine Reduktion der Infektionen um den Faktor 20 erreicht werden. Die Impfung muss jährlich geboostert werden, wobei der Zeitpunkt so gewählt werden soll, dass in der Regenzeit optimaler Schutz gewährleistet ist. Wünschenswert wären Impfungen für Schwangere, ältere Kinder und generell Erwachsene.
Mehrere Vakzine auf Basis unterschiedlicher Technologien und mit unterschiedlichen Zielen befinden sich in Phase-I- oder -II-Studien. Unter anderem wird versucht, mit genetisch modifizierten Plasmodien eine Immunisierung zu erreichen. Bei der GA2-Variante wurde das mei2-Gen entfernt (PfΔmei2), was dazu führt, dass die Entwicklung des Parasiten in der Leber nicht vollständig durchlaufen werden kann. Diese Impfvariante kann ebenso wie intakte Plasmodien durch Mücken verbreitet werden. In einer ersten Studie erkrankte von 15 Geimpften nur einer an Malaria – in der Placebogruppe erkrankten alle Probanden.1
RSV-Impfung für Schwangere schützt auch das neugeborene Kind
Relativ neu ist die Option, gegen das respiratorische Synzytial-Virus (RSV) zu impfen. Die Krankheitslast durch RSV sollte nicht unterschätzt werden. In der Personengruppe über 65 Jahre führen vor allem Komorbiditäten wie COPD, Asthma oder Niereninsuffizienz zu einem gesteigerten Hospitalisierungsrisiko. Aktuell stehen drei Impfstoffe zur Verfügung, nämlich der adjuvantierte Proteinimpfstoff Arexvy, der Proteinimpfstoff Abrysvo sowie der mRNA-Impfstoff mResvia. Arexvy und mResvia sind grundsätzlich ab 60 Jahren zugelassen, wobei für Arexvy zudem die Zulassung für Risikopersonen ab 50 Jahren besteht. Abrysvo ist ab 18 Jahren zugelassen sowie für Schwangere im dritten Trimenon, wodurch das Neugeborene durch dia-plazentare maternale Antikörper in den ersten Monaten geschützt wird.2
Zusätzlich steht der monoklonale Antikörper Nirsevimab (Beyfortus) für die passive Immunisierung von Neugeborenen, Säuglingen und Kleinkindern zur Verfügung. Nirsevimab ist für alle Säuglinge, die ab 1.April 2025 geboren sind, im Kinderimpfprogramm kostenlos erhältlich (Details dazu finden sich in der aktuellen Version des Österreichischen Impfplans).2
Dieser Schutz ist von Bedeutung, da RSV für Säuglinge eine relevante Gesundheitsgefahr bedeutet. Retrospektive Studiendaten über sieben Saisonen zeigen, dass davon nicht nur Frühgeborene, sondern auch reif Geborene betroffen sind. Die Infektionen ereigneten sich zu 79% im ersten Lebensjahr, nur 11% der Betroffenen litten unter Komorbiditäten. Klinisch lag in 80% der Fälle eine Bronchiolitis, in 8% eine Pneumonie vor. Mehr als die Hälfte der betroffenen Kinder benötigten Sauerstoff, in 13% war eine unterstützte Beatmung erforderlich.3,4
Bei Erwachsenen wird die Möglichkeit einer Immunisierung gegen RSV leider schlecht angenommen, was auch für die Impfungen gegen Influenza, Covid-19 und Pneumokokken gilt. Eine sinnvolle Strategie, die Impfbereitschaft zu verbessern, könnte darin liegen, die Zielgruppe ältere Menschen über das erhöhte Risiko von Folgeschäden bakterieller und viraler Infektionen zu informieren, so Koppelstätter. Ein geeigneter Slogan wäre: „Impfen gegen Herzinfarkt, Schlaganfall und Demenz.“
Quelle:
„Ab sofort impfpräventabel: Chikungunya, Dengue, Malaria, RSV und Co.“, Vortrag von Dr. Sabine Koppelstätter, Innsbruck, im Rahmen des ÖIK 2025, Saalfelden
Literatur:
1 Roozen GVT et al.: Nat Med 2025; 31(1): 218-22 2 Sever Yildiz G et al.: Influenza Other Respir Viruses 2024; 18(11): e70046 3 Quarg C et al.: Eur J Med Res 2023; 28(1): 568 2 Impfplan Österreich 2025/2026. Version 1.1 vom 10. Oktober 2025; https://www.sozialministerium.gv.at/dam/jcr:7b3826a7-9eb5-4835-affd-f6e6e3f62bf4/2025-10-10%20Impfplan_%C3%96sterreich_2025_2026_Version%201.1.pdf ; zuletzt aufgerufen am 27.10. 2025 3 Sever YildizG et al.: Influenza Other Respir Viruses 2024; 18(11):e700464 Quarg C et al.: Eur J Med Res 2023; 28(1): 568
Das könnte Sie auch interessieren:
Antimykotika-resistente Pilze sind in Österreich (noch) ein seltenes Problem
Ebenso wie Antibiotikaresistenzen werden auch Resistenzen von Pilzen gegen Antimykotika weltweit zum Problem – von dem Österreich glücklicherweise bislang kaum betroffen ist. ...
HIV-Infektion im Alter: Was sind die Herausforderungen?
Dank des medizinischen Fortschritts ist HIV heute eine chronische behandelbare Erkrankung mit nahezu normaler Lebenserwartung. Immer mehr HIV-positive Menschen erreichen ein höheres ...
Die neue Candida-Leitlinie 2025 in der klinischen Praxis
2025 ist das Update der globalen Leitlinie zum Management von Candida-Infektionen erschienen. Die Guideline fasst die aktuelle Evidenz in Form übersichtlicher, praxisnaher Algorithmen ...